Energieausweise können auf der Grundlage des Energieverbrauchs (Verbrauchsausweis) von 3 zusammenhängenden Jahren ausgestellt werden.

- Heizwert/Brennwert des Energieträgers
- Anteil des Verbrauchs an der Warmwasserbereitung
- Witterungsbereinigung des Verbrauchs
- Berücksichtigung von Leerständen
Regelungen zur Berechnung werden vom Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR) herausgegeben.
»Aktuelle Bekanntmachungen des BBSR
Verbrauch bei Gasetagenheizung
(wohnungszentrale Heizung)
Werden die Wohnungen eines Gebäudes einzeln durch Gasetagenheizungen oder Nachtspeicherheizungen versorgt, benötigen Sie die Abrechnungen aller Wohnungen. Da die Daten bei vermieteten Wohnungen oft nur schwer zu ermitteln sind, bieten die meisten Energieversorger die Zusammenfassung der Daten (Verbrauchsanalyse) zur Ausstellung eines Energieausweises an. Fragen Sie Ihren Energieversorger, ob er diese Leistung anbietet!
Witterungsbereinigung
Bei der Witterungsbereinigung wird nur der Anteil des Verbrauchs berücksichtigt, der nicht zur Warmwasserbereitung benötigt wird. Für die Witterungsbereinigung wird der Klimafaktor als Quotient aus Gradtagszahl der Verbrauchsperiode und einem langjährigen Mittelwert für Deutschland (GT=3883Kd/a, Model: 20/15) ermittelt. Dieser Klimafaktor wird mit dem Verbrauchswert der Abrechnungsperiode (grundsätzlich 1 Jahr) multipliziert.
Berücksichtigung von Leerständen
Grundsätzlich sollen nur längere Leerstände bei der Berechnung angemessen berücksichtigt werden. Zu diesem Zweck soll die Gebäudenutzfläche um die zu berücksichtigenden Leerstände verringert werden.
Genauer ist das Verfahren zur Berücksichtigung von Leerständen in der Bekanntmachung des Bundesministeriums nicht beschrieben. Es gibt keinen Hinweis darauf was unter "längeren Leerständen" zu verstehen ist. Das Verfahren berücksichtigt nicht die Tatsache, dass Leerstände in den Sommermonaten zu einem unangemessen höheren Verbrauchswert führen.
Bei energie-m Energieberatung werden die Leerstände auch über einen Flächenabzug bei der Berechnung der Kennwerte berücksichtigt. Um die ungleichen Verbrauchswerte innerhalb eines Jahres zu berücksichtigen, werden die Leerstandsflächen für den Kennwert des Heizenergieverbrauchs mit einem Klimafaktor in Anlehnung an VDI 2067 Blatt 1, Tab. 22 (Gradtagtabelle) multipliziert. Für den Energiebedarf zur Trinkwassererwärmung werden die Leerstandsflächen mit dem Anteil der Tage am Verbrauchsjahr multipliziert. Auch diese Berechnungsmethode berücksichtigt Leerstände nur näherungsweise. Sie lassen sich jedoch korrekter abbilden, als ohne Bereinigung mittels Gradtagzahlen.
Gebäudenutzfläche AN
Die Gebäudenutzfläche AN ist eine fiktive Grundfläche, die mit der Wärmeschutzverordnung 1994 (WärmeschutzV) eingeführt wurde. Sie errechnet sich aus dem Gebäudevolumen:
AN = 0,32 * V
Grundlage für diese Formel waren typische lichte Raumhöhen im Wohnungsbau von 2,60 m. Da diese Flächenangabe seitdem Grundlage für Berechnungen nach der WärmeschutzV und der EnEV ist, wird sie auch für Energieausweise verwendet.
Nach der DIN V 18599-1 ist die Bezugsfläche die Nettogrundfläche (NGF) des konditionierten (beheizten) Gebäudes. Die Berechnung der Gebäudenutzfläche AN nach § 19 Abs. 2 EnEV entspricht etwa der Nettogrundfläche. Es gelten folgende Formeln:
- Ein- und Zweifamilienhäuser mit beheiztem Keller: AN = AWohnfäche * 1,35
- Für alle sonstigen Wohngebäude: AN = AWohnfläche * 1,2
Angaben zum Energieverbrauch auf dem Energieausweis
Der Energieverbrauch wird im Energieausweis grundsätzlich als (unterer) Heizwert Hi in kWh angegeben. Wird der Verbrauch in einer anderen Einheit gemessen (z.B. m³) oder als Brennwert (Hs, z.B. bei der Gasabrechnung) angegeben, wird der Verbrauchswert entsprechend umgerechnet.
Links
Anlässlich der Ausstellung eines Energieausweises müssen auf jeden Fall "Empfehlungen für die Verbesserung Energieeffizienz" (§ 20 Abs. 1 EnEV bzw. § 84 GEG) gemacht werden. Dies gilt auch, wenn ein Energieausweis auf der Grundlage des Energieverbrauchs ausgestellt wird.
Die Aussteller von Energieausweisen sind deshalb auf jeden Fall verpflichtet, das Gebäude, für das sie einen Energieausweis ausstellen, auf mögliche Verbesserungen hin zu untersuchen. Insofern sind die meisten Online-Angebote zur Ausstellung von Energieausweisen nicht verordnungskonform, da sie den Zustand des Gebäudes nicht berücksichtigen und meist keine konkreten Empfehlungen für die Verbesserung der Energieeffizienz (Modernisierungsempfehlungen) geben.
Was sind "kostengünstige Verbesserungen"
Die Formulierung ist direkt aus der Effizienzrichtlinie (RL 2002/91/EG) entnommen. Im Artikel 7 Abs. 2 heißt es dort:
"... Dem Energieausweis sind Empfehlungen für die kostengünstige Verbesserung der Gesamtenergieeffizienz beizufügen."
Das Ziel der Formulierung erschließt sich nicht direkt aus dem Verordnungstext, wird aber aus der Begründung zur Novelle der EnEV deutlich. Der Begriff "kostengünstig" hat hier dieselbe Bedeutung wie im Energieeinsparungsgesetz (vgl. Ausschussbericht zum EnEG 2005, Bundestags-Drucksache 15/5849, S. 7 zu Nummer 1b: "Die Einfügung des Wortes 'kostengünstig' ... soll ... den Gedanken der Rentabilität der Maßnahmen hervorheben, die zur Verbesserung der Energieeffizienz eines Gebäudes empfohlen werden. Der aus Art. 7 Abs. 2 der Richtlinie übernommene Begriff 'kostengünstig' ist im Wesentlichen im Sinne des Begriffs 'wirtschaftlich vertretbar' zu verstehen, wie er in § 5 Abs. 1 EnEG verwendet wird").

Es ist grundsätzlich zulässig, für die Beurteilung des Gebäudes auf Angaben des Gebäudeeigentümers zurückzugreifen. In der Begründung zur EnEV wird ausdrücklich darauf verwiesen, dass eine "kostenträchtige 'Hausbesichtigung' vermieden werden" kann. Das GEG fordert entweder eine Begehung vor Ort oder das geeignete Bildaufnahmen zur Verfügung gestellt werden (§ 84 Abs. 1 GEG).
Im Gebäudeenergiegesetz wird darüber hinaus der Begriff "kostengünstig" durch "kosteneffizient" ersetzt. Damit soll klar gestellt werden, dass die Maßnahmen vor allem im wirtschaftlichen Sinn effizient sein sollen.
Um Ihnen beim Onlineangebot von energie-m Energieberatung konkrete Modernisierungsempfehlungen geben zu können, wird deshalb der Zustand Ihres Gebäudes abgefragt.
Weblinks
Online-Energieausweise sind oftmals ungültig. Die Energieausweise von energie-m Energieberatung erfüllen dagegen besondere Qualitätsmaßstäbe und können über ein Online-Formular direkt bestellt werden.
Als Ausführungsarten sind nach DIN EN 1996-1-1 (Definitionen Nr. 1.5.10.x) folgende Konstruktionen genormt:
- Zweischalige Wand mit Luftschicht
- Zweischalige Wand mit Luftschicht und Wärmedämmung
- Zweischalige Wand mit Kerndämmung
- Zweischalige Wand ohne Luftschicht (Fuge mit Mörtel voll ausgefüllt)
- Verfüllte zweischalige Wand (Zwischenraum mit Beton oder Vergussmörtel verfüllt)
- Zweischalige Wand mit Vorsatzschale
Obwohl zunehmend alte Kastenfenster durch Einfachfenster mit Isolierverglasung ausgetauscht werden, ist es in vielen Fällen dennoch sinnvoll die alten Fenster zu sanieren. Bei denkmalgeschützten Gebäuden kommt ein Austausch der Kastenfenster meist ohnehin nicht in Frage. Wird nicht gleichzeitig mit dem Austausch der Fenster die Wärmedämmung der Fassade verbessert (Wärmedämmverbundsystem), kommt es nach dem Einbau von Einfachfenstern mit Isolierverglasung oft zu ärgerlichen Wärmebrücken im Bereich der Fensterlaibungen. Dieses Problem lässt sich mit einer fachgerechten Modernisierung der bestehenden Kastenfenster verhindern. Dabei lassen sich Kastenfenster mittels einer beschichteten Verglasung oder einer Wärmeschutzverglasung im Innenflügel so modernisieren, dass sie nach der Modernisierung einen mit einem neuen Fenster vergleichbaren Wärmeschutz aufweisen.
| Fenstertyp | Uw-Wert |
|---|---|
| Einfachfenster mit Einfachverglasung (Flachglas) | 4,6 W/(m²K)DIN |
| Einfachfenster mit Einfachverglasung (K Glass™) | 2,9 W/(m²K)DIN |
| Einfachfenster Bestand mit dünner Isolierverglasung (4-6-4) | 2,6 W/(m²K)DIN |
| Einfachfenster mit alter Isolierverglasung (Ug=2,8) oder Verbundfenster | 2,6 W/(m²K)DIN |
| Kastendoppelfenster (Bestand) | 2,3..2,5 W/(m²K)DIN |
| Verbundfenster (nach Modernisierung) mit K Glass™ | 1,8 W/(m²K)* |
| Kastendoppelfenster (nach Modernisierung) mit K Glass™ | 1,7 W/(m²K)DIN |
| Kastendoppelfenster (nach Modernisierung) mit Wärmeschutzverglasung im inneren Flügel 3-6-3 Argonfüllung |
1,4 W/(m²K)DIN |
| Kastendoppelfenster (nach Modernisierung) mit Vakuum-Verglasung im inneren Flügel Ug=0,7 W/(m²K) |
1,0 W/(m²K)DIN |
| Einfachfenster (Holzrahmen IV 68) mit 2-fach Wärmeschutzverglasung (Ug=1,0) |
1,3 W/(m²K)DIN |
| Einfachfenster (Holzrahmen IV 90) mit 3-fach Wärmeschutzverglasung (Ug=0,6) |
0,90 W/(m²K)DIN |
* → kF Messung nach DIN 52619-1 beim i.f.t. Rosenheim
DIN → Berechnete Werte nach DIN 4108-4 [2004-07] Nr. 5 und ISO 10077
Zu einer fachgerechten Modernisierung von Kastenfenstern gehört:
- Fenster gang- und schließbar machen
- Abdichtung der Anschlüsse zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk (Außenwand)
- Verbesserung der Abdichtung des Innenflügels durch umlaufende eingefräste Schlauchdichtung; die Außenflügel sollen nach der Modernisierung luftdurchlässig sein
- Verbesserung der Schlagregendichtigkeit durch größeren Überstand der Wassernasen, erneuerte Falzprofilierung und Blechauflage sowie durch ein zusätzliches Dichtungsprofil am unteren Rahmenprofil
- Austausch der inneren Fensterscheibe durch K Glass™ der Firma Pilkington
- Erneuerung der Abdichtung am Glasfalz durch lackierten Glasfalz, Verglasung mit Vorlegeband und elastischer Versiegelung
- Malermäßige Instandsetzung des Fensters
Eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Arbeitsschritte und Fehlerquellen hat der »VFF in seinem Leitfaden HO.09 "Runderneuerung von Kastenfenster aus Holz" [2014.10] zusammengestellt.
Verbesserung des Wärmedurchgangskoeffzienten durch K Glass™
Pilkington K Glass™ ist ein normales Floatglas, das einseitig mit Metalloxid pyrolytisch beschichtet ist. Die Beschichtung ist chemisch und mechanisch sehr widerstandsfähig. In der Regel wird dieses Glas für Isolierglasfenster eingesetzt. Es kann aber wegen der Widerstandsfähigkeit der Beschichtung auf bei der Modernisierung von Verbund- und Kastenfenstern verwendet werden.
Pilkington K Glass™ ist in der Ansicht und in der Durchsicht neutral. Durch den Einsatz von K Glass™ in Kastenfenstern verringert sich der Ug-Wert der Verglasung von 2,9 W/(m²K) auf 1,9 W/(m²K).
Die mit Metalloxid beschichtete Glasoberfläche sollte in der Regel auf Position #3 (auf der raumseitigen Scheibe zum Scheibenzwischenraum hin) eingebaut werden. Es ist jedoch auch möglich, die Beschichtung auf Position #2 (auf der äußeren Scheibe zum Scheibenzwischenraum hin) einzusetzen. Die Lichtdurchlässigkeit und der Ug-Wert ändert sich dadurch nicht. Nur der g-Wert verringert sich von 0,74 auf 0,69.
Selbst bei Einfachverglasungen verbessert sich die Wärmedämmung durch den Einsatz von K Glass™, da sich der innere Wärmeübergangswiderstand erhöht. Der Ug-Wert verringert sich von 5,78 W/(m²K) auf 2,99 W/(m²K).
Hinweis: Beschichtete Scheiben können ganz normal geputzt werden. Verunreinigungen dürfen jedoch auf der beschichteten Seite nicht mit harten Gegenständen (Cutter, scharfe Messer etc.) entfernt werden, da die Beschichtung ansonsten dauerhaft durch den Abrieb beschädigt wird. Auch Farbe beim Anstreichen der Fensterrahmen, lässt sich von der Beschichtung nicht oder nur mit Lösungsmitteln entfernen.
Wärmeschutzverglasungen in Kastenfenstern
Eine weitere Verbesserung des U-Wertes von Kastenfenstern ist durch eine Verglasung mit einer dünnen Wärmeschutzverglasung (beschichtete Isolierverglasung) möglich. Bei der Verglasung sollte darauf geachtet werden, dass ein thermisch verbesserter Randverbund (warme Kante) verwendet wird. Bei der Verwendung dünner Gläser (Dicke 3 mm) mit 6-8 mm Scheibenzwischenraum kann eine Wärmeschutzverglasung mit 12-14 mm Gesamtdicke ausgeführt werden.

Verwendet man eine Vakuum-Verglasung mit einem U-Wert von ca. Ug=0,7 W/(m²K) kann man den U-Wert des gesamten Fensters auf Werte bis zu UW = 1,0 W/(m²K) reduzieren.
Weblinks
Menschen fühlen sich in Räumen mit frischer Luft behaglicher als in schlecht gelüfteten oder zugigen Räumen. Mit zunehmender Verbesserung der Gebäudehülle rücken auch Lüftungswärmeverluste und Undichtigkeiten in der Gebäudehülle in den Fokus der energetischen Optimierung.
Zwar wird die Fensterlüftung oft als die "sympathischste Lösung" zur Belüftung empfunden, doch liegen die Eigenwahrnehmung des Nutzers und der tatsächlich erreichte Luftwechsel eben so oft weit auseinander. Undichtigkeiten in den Fenstern und Türen, in Wänden und Dächern können zwar einen hygienischen Luftwechsel verbessern, verursachen aber gleichzeitig unangenehme Zugluft und führen in der Regel zu Feuchteschäden (Tauwasserausfall und Schimmelpilzbildung). Bei neuen Gebäuden ist außerdem eine dichte Gebäudehülle obligatorisch.
Zum Nachweis des hygienisch notwendigen Luftwechsels ist ein »Lüftungskonzept (nach DIN 1946-6) notwendig.
Bei gut gedämmten Gebäuden machen Lüftungswärmeverluste bis zu 50% der Wärmeverluste aus. Als Lösung für diese Probleme bietet sich eine kontrollierte Wohnungslüftung an. Im einfachsten Fall besteht diese aus einer Abluftanlage, die einen kontrollieren Luftwechsel gewährleistet. Die Zuluft wird über geplant angeordnete Lüftungsöffnungen über den Heizkörpern zugeführt.
Besser ist allerdings eine Abluft- / Zuluftanlage. Hier können auch die Volumenströme der Zuluftöffnungen genau eingeregelt werden. Beide Anlagen habe leider einen Nachteil: Die Wärmeenergie der Abluft geht verloren und muss dem Gebäude über die Heizung wieder zugeführt werden.
Mit einem Wärmetauscher kann man den größten Teil der Wärme aus der Abluft zurückgewinnen (bis zu 95%). Die Vorteile einer solchen Anlage liegen auf der Hand:
- Die kontrollierte Wohnungslüftung sorgt bei gut gedämmten und luftdichten Gebäuden für einen hygienischen Luftwechsel.
- Lüftungswärmeverluste können mit einem Wärmetauscher weitgehend verhindert werden.
- Feuchteschäden (Tauwasserausfall und Schimmelpilzbildung) werden vermieden, da die kontrollierte Wohnungslüftung unabhängig vom Nutzerverhalten arbeitet.
- Feinfilter an den Lüftungsöffnungen verhindern dauerhaft die Verschmutzung der Anlage.
Anlagen zur kontrollierten Wohnungslüftung sollten nicht mit Klimaanlagen, wie sie in Bürogebäuden eingebaut werden, verwechselt werden. Die kontrollierte Wohnungslüftung wird ausschließlich dazu benutzt, Wohnräume mit frischer Luft zu versorgen. Die dazu notwendigen Volumenströme sind sehr niedrig (ca. 0,4-0,5 h-1). Es entstehen weder unangenehme Luftbewegungen noch störende Geräusche.
Weblinks
energie-m Energieberatung in Berlin stellt Ihnen Energieausweise nach dem Gebäudeenergiegesetz (»GEG 2020) aus.
Energieausweise wurden mit der »Novellierung der EnEV 2007 eingeführt. Sie ersetzen den Energiebedarfsausweis nach EnEV 2000/2004 und den »Energiepass der dena.

Energieausweise können entweder auf der Grundlage des berechneten Energiebedarfs oder des gemessenen Energieverbrauchs ausgestellt werden. Für die Verwendung von Energieausweisen ist es egal auf welcher Grundlage der Energieausweis ausgestellt wurde. Beide Arten können gleichwertig angewendet werden.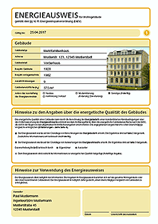
Um den Energiebedarf eines Gebäudes zu ermitteln, werden die Konstruktion des Gebäudes und seine wärmetechnischen Anlagen bewertet. Der Energiebedarf wird dann für eine durchschnittliche Nutzung ermittelt und ist unabhängig vom Nutzerverhalten.
Für folgende Gebäude müssen »Energieausweise auf der Grundlage des Energiebedarfs ausgestellt werden:
- neue Gebäude,
- geänderte Gebäude, bei denen Berechnungen nach § 50 GEG durchgeführt werden und
- Wohngebäude mit weniger als 5 Wohnungen, deren Bauantrag vor dem 1.11.1977 gestellt wurde.
Die Ausstellung von Energieausweisen auf der Grundlage des Energiebedarfs ist relativ aufwendig. Deshalb können »Energieausweise auf der Grundlage des Energieverbrauchs kostengünstig ausgestellt werden. Grundlage für die Berechnung ist der Energieverbrauch der letzten 3 Jahre vor der Ausstellung des Energieausweises. Diese Berechnung ist kostengünstig, aber stark vom Nutzerverhalten eines Gebäudes abhängig.
Sind Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz bei Bestandsgebäuden möglich, so gehören diese »Modernisierungsempfehlungen als Anlage zum Energieausweis.
Energieausweise gelten für die Dauer von 10 Jahren.
Seit der »EnEV 2013 änderten sich ab 2014 die Anforderungen zu Energieausweisen:
- Für Energieausweise ist eine Registriernummer der Registrierstelle notwendig (§ 78 GEG).
- Die Aushangpflicht für Gebäude mit starkem Publikumsverkehr gilt ab 500 m² Nutzfläche und bei behördlicher Nutzung mit starkem Publikumsverkehr ab 250 m² Nutzfläche (§ 80 Abs. 6+7 GEG).
- Energieausweise müssen bei Verkauf/Vermietung von bestehenden Gebäuden vorgelegt oder ausgehängt werden (§ 80 Abs. 4).
- In Immobilienanzeigen sind folgende Pflichtangaben anzugeben: Art des Energieausweises, Endenergiebedarf bzw. -verbrauch, wesentliche Energieträger, Baujahr, Energieeffizienzklasse (§ 87 GEG), soweit ein Energieausweis vorliegt.
- In Energieverbrauchsausweisen ist in jedem Fall der Energieverbrauch für die Warmwasserbereitung anzugeben (§ 82 Abs. 2 GEG).
Seit der Anwendung des »GEG 2020 gibt es folgende zusätzliche Anforderungen:
- Findet keine Begehung des Ausweis-Ausstellers vor Ort statt, muss der Eigentümer dem Aussteller zur Beurteilung der energetischen Eigenschaften geeignete Bildaufnahmen zur Verfügung stellen (§ 84 GEG)
Für die Anwendung der neuen Pflichtangaben in Immobilienanzeigen hat das BMWi eine Bekanntmachung (»Arbeitshilfe vom 17.04.2014) herausgegeben, in der geregelt ist, wie mit vorhandenen, vor Mai 2014 ausgestellten Energieausweisen umzugehen ist. Bei neuen Gebäuden ist ein Energieausweis erst nach der Fertigstellung des Gebäudes auszustellen (§ 80 Abs. 1 GEG). Die Vorlagepflicht von Energieausweisen beim Verkauf nach § 80 Abs. 4 GEG gilt nur für bestehende Gebäude und bereits fertig gestellte Gebäude, für die bereits ein Energieausweis ausgestellt wurde.
Weblinks
- »Informationen zur EU-Gebäuderichtlinie (EPBD)
- »Informationen zum Gebäudeenergiegesetz (GEG)
- »Energieausweis auf der Grundlage des Energieverbrauchs
- »Energieausweis auf der Grundlage des Energiebedarfs
- »Ist der Online-Energieausweis zulässig?
- »Modernisierungsempfehlungen des GEG
- »Arbeitshilfe Pflichtangaben in Immobilienanzeigen und "alte" Energieausweise (BAnz AT 30.04.2014 B1)
Die EnEV 2007 galt vom 1.10.2007 bis zum 30.09.2009. Sie wurde im Oktober 2009 von der »EnEV 2009 abgelöst.
Die Novelle der Energieeinsparverordnung (EnEV) aus dem Jahre 2002 wurde am 24.7.2007 im Bundesgesetzblatt (BGBl. 2007, Teil 1, Nr. 34) verkündet und galt seit dem 1.10.2007. Mit der EnEV 2007 wird die »EU-Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden umgesetzt.
Die wesentlichen Neuerungen sind:
- Einführung von Energieausweisen
- Aushang von Energieausweisen in öffentlichen Gebäuden mit Publikumsverkehr
- Neues Berechnungsverfahren für Nicht-Wohngebäude (Einbeziehung von Klimaanlagen und Beleuchtung in die Berechnung)
- Die Regelungen für Gebäude mit niedrigen Innentemperaturen entfallen
- Vereinfachungen im Berechnungsverfahren für Bestandsgebäude
- Anforderungen an und Inspektionen von Klimaanlagen
- Einsatz alternativer Systeme in der Anlagentechnik bei Gebäuden über 1.000 m²
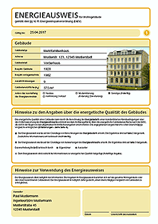 Für den Neubau von Wohngebäuden wird es keine wesentlichen Änderungen geben. Die Einführung von Energieausweisen betrifft aber schrittweise auch den Altbaubestand.
Für den Neubau von Wohngebäuden wird es keine wesentlichen Änderungen geben. Die Einführung von Energieausweisen betrifft aber schrittweise auch den Altbaubestand.
Eine Verpflichtung für die Ausstellung eines Energieausweises entsteht immer dann, wenn ein Gebäude verkauft oder vermietet werden soll. Gleiches gilt bei Erneuerungen von Außenbauteilen oder Erweiterungen der beheizten Grundfläche um mehr als 10 m².
Die wesentliche Neuerung der EnEV ist das Berechnungsverfahren für Nichtwohngebäude. Diese Gebäude werden auf der Grundlage der neuen DIN V 18599 bilanziert. Die Regelungen für Gebäude mit niedrigen Innentemperaturen entfallen deshalb. Bei der Bilanzierung von Nichtwohngebäuden wird auch der Energiebedarf für Beleuchtung und für Klimatisierung mit berücksichtigt.
Weblinks
- Informationen zum Energieausweis
- Details zur EnEV 2007
- EnEV 2007 (Beschlussfassung des Bundeskabinetts vom 27.6.07)
- Pressemitteilung des BMWi vom 27.06.07
- Internetseiten der Ministerien: »BMVBS, »BMWi und »BBR